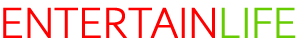Wenn du dachtest, die Sowjetunion sei mit dem Zerfall der Berliner Mauer gestorben, dann halt dich fest. Denn in einem nebligen Tal an der Ostküste des Schwarzen Meeres – irgendwo zwischen Postkarte und postapokalyptischem Filmset – liegt eine Stadt, die den Kalten Krieg offenbar einfach ignoriert hat: Tkwarcheli, ein Ort, an dem Stalin höchstpersönlich jederzeit um die Ecke kommen könnte, um dir dein Brot zu konfiszieren.
Willkommen in Abchasien – oder Georgien, je nachdem, wen du fragst. Ein politisches Bermuda-Dreieck, das international nur von Russland, Venezuela, Nicaragua und ein paar anderen geopolitischen Hipstern als eigenständig anerkannt wird.

Aus dem Kohleofen der Geschichte
Tkwarcheli wurde in den 1940er Jahren gegründet – im besten Stalin-Design – mit dem Ziel, den sowjetischen Kohlebedarf zu stillen. Kohle war damals heißer als TikTok heute. Und weil man dachte, der Sozialismus würde ewig halten, baute man die Stadt auch gleich für die Ewigkeit. Leider vergaß man dabei, was nach der Ewigkeit kommt.


In den 1990er Jahren tobte der Unabhängigkeitskrieg – eine Art Balkankrieg mit Schwarzmeerpanorama. Die Georgier versuchten, die Stadt auszuhungern (sehr oldschool), bis russisch-unterstützte abchasische Kräfte sie zurückeroberten. Danach ging’s bergab: Die Bevölkerung schrumpfte von 40.000 auf unter 5.000, und das nicht nur, weil niemand mehr Kohle wollte, sondern weil auch niemand mehr dort wohnen wollte.

Ben Rich auf geheimer Mission (oder doch nur ein Touri?)
Letztes Jahr wagte sich der mutige Urbexer (Urban Explorer) Ben Rich von Desolation Travel nach Tkwarcheli. Sein Fahrer war sich nicht sicher, ob er ein Tourist oder ein Spion sei – wahrscheinlich beides. Denn wer reist freiwillig in eine vergessene Stadt, in der selbst Google Maps lieber nicht reinzoomt?
„Um die Kurve gebogen, lag Tkwarcheli vor uns – wie ein hässlicher Pickel in einem schönen Gesicht. Die Stadt war alt, grau, tot. Und gleichzeitig umgeben von einer üppigen, fast frechen Natur, die so gar nicht wusste, dass hier mal der Sozialismus regiert hat.“
Ben beschreibt Straßen, auf denen nur vereinzelt klapprige Ladas fuhren, und Menschen, die schauten, als hätten sie seit der letzten Parteiversammlung niemand Fremdes mehr gesehen. Die Schilder über den Geschäften? Handgemalt. „Schuhe“. „Produkte“. „Brot“. Man fühlte sich weniger wie auf Reisen, mehr wie auf dem Set eines dystopischen Netflix-Dramas.


Wohnungen mit Aussicht – auf Angst
„Die schönsten Wohnungen in der Stadt standen an einem Kreisverkehr mit Blick auf die einzige Straße hinein. Zu gut gebaut für Arbeiter – das waren die Quartiere der sowjetischen Elite. Parteibonzen, KGBler, Direktoren. Kurz: Leute, die wussten, wie man mit einer Liste Namen Karriere macht.“
Es waren nicht nur Gebäude – es waren Mahnmale. An Paranoia, Verrat und das tägliche Misstrauen, dass selbst dein Wellensittich ein Spitzel sein könnte.

Die Geister, die sie riefen
„Zum ersten Mal auf meinen Reisen spürte ich den eisigen Hauch jener Zeit. Die Kälte im Nacken, wenn du an einem Gebäude vorbeigehst, in dem Menschen verschwanden. Tkwarcheli war kein Ort – es war ein Gefühl. Ein Knoten im Magen. Eine sowjetische Zeitschleife.“
Wer wissen will, wie es war, in Stalins Schatten zu leben, sollte Tkwarcheli besuchen – oder eben nicht. Denn man verlässt diesen Ort mit einem seltsamen Gefühl. Einer Mischung aus Faszination, Abscheu und dem dringenden Bedürfnis, zu duschen.

Fotografie von V. Mulder